Problemlösungen auf der Spur
Grundverständnis Wirkungsorientierung
Was ist Wirkungsorientierung?
Wirkungsorientierung bedeutet, dass ein Projekt systematisch auf die erwünschte Wirkung hin geplant werden muss. Auch während der Umsetzung ist laufend zu überprüfen, ob sich das Präventionsvorhaben in Richtung der formulierten Wirkungsziele bewegt. Am Ende ist festzuhalten, was aus den Ergebnissen und Erfahrungen für künftige Präventionsvorhaben gelernt werden kann. Idealerweise wird auch analysiert, inwieweit die Wirkungsziele erreicht wurden.


Was leistet Wirkungsorientierung?
Wer mit Präventionsaufgaben befasst ist, möchte auch Präventionswirkungen erzielen. Die entscheidende Frage ist, wie lassen sich diese Präventionswirkungen tatsächlich erreichen und wie ist dabei vorzugehen? Der wirkungsorientierte Ansatz bietet dazu einen erfolgreichen Lösungsweg. Er stützt sich auf bewährte, fachlich anerkannte Standards zur Qualitätssicherung. Dazu gehört eine strukturierte, systematische Anwendung von genau beschriebenen Arbeitsschritten, die sowohl bei der Konzeptionsentwicklung als auch der Durchführung von Präventionsprojekten einzuhalten sind. Der wirkungsorientierte Ansatz schafft die Grundlage dafür, dass ein Projekt Wirksamkeit entfalten kann.
Wirkungsorientierung bedeutet aber auch, dass im Zuge der Konzeptionsentwicklung der bestmögliche und effiziente Einsatz von Ressourcen vorgesehen wird. Fehlinvestitionen in fachlich nicht tragfähige Ansätze, in wirkungslose oder sogar kontraproduktive Maßnahmen werden vermieden. Eine qualitativ hochwertige Konzeption ebnet also nicht nur der Weg zur Wirksamkeit, sondern auch zum effizienten und schonenden Umgang mit Ressourcen.
10 gute Gründe
Der wirkungsorientierte Ansatz hat überzeugende Vorteile. Mit ihm lässt sich ein fachlich belastbarer Präventionsansatz entwickeln, eine gut durchdachte Planung erarbeiten und die Umsetzung des Projekts so vorantreiben, dass die Zielerreichung kontinuierlich im Blick bleibt.
Die Vorteile im Einzelnen sind:

Wirkungsorientierung kommt vor Wirkungsmessung!
Wenn es darum geht, Prävention wirksam zu gestalten, helfen dann nur Wirksamkeitsmessungen weiter? Welche Möglichkeiten gibt es, sich über die Qualität der Präventionsarbeit und ihrer Ergebnisse Klarheit zu verschaffen? Wirkungsorientierung setzt in erster Linie darauf, eine qualitativ hochwertige Konzeption und sorgsame Überwachung der Umsetzung zu erreichen, weil nur dies Wirksamkeit schafft. Erst in zweiter Linie geht es dann um die Überprüfung bzw. Messung dieser Wirksamkeit.
In dem Maße, wie der Aufwand bei einem Präventionsprojekt zunimmt, erscheint es umso wichtiger zu prüfen, ob mit den praktizierten Ansätzen und Aktivitäten die angestrebten Ziele tatsächlich erreicht werden konnten. Für Planung und Durchführung einer Wirkungsevaluation sind allerdings gute Methodenkenntnisse erforderlich. Je nach methodischem Ansatz und vorhandenen Kompetenzen der im Projekt mitwirkenden Personen kann eine Wirkungsmessung projektintern geleistet werden oder aber die Unterstützung externer Fachleute erfordern. Die Wirkungsmessung ist kein (zwingender) Bestandteil des wirkungsorientierten Vorgehens, wird aber grundsätzlich empfohlen.
Wie funktioniert Wirkungsorientierung?
Das wirkungsorientierte Vorgehen beginnt mit der genauen Erfassung des Problems und seiner Ursachen. Diese Analyse ist unverzichtbar und bildet die Grundlage für alles Weitere. Nur wenn die Ursachen für das Problem erkannt und präzise beschrieben sind, ist es möglich, geeignete Maßnahmen davon abzuleiten. Ansonsten würden die Projektaktivitäten an der Problemlösung vorbeilaufen. Schon in einer frühen Phase werden also die Weichen gestellt, ob ein Projekt die Ziele überhaupt erreichen kann.
Das Wissen um die Ursachen ist auch deshalb notwendig, um die Akteure zu bestimmen, die auf diese Ursachen Einfluss haben. Wer verfügt über notwendige Kompetenzen? An welchen Stellen ist die Polizei zuständig und wo nicht? Welche Kooperationspartner müssen zusammengebracht werden? Wirkungsorientierung bedeutet nicht nur, geeignete Präventionsmaßnahmen zu finden und einen effizienten Einsatz der Mittel zu planen. Es geht auch darum, diejenigen Gruppen, Institutionen und Betroffenen zu identifizieren, die eingebunden werden müssen, um die Präventionsziele zu erreichen.
Um ein Projekt wirkungsorientiert zu gestalten, finden Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mit dem Praxiswerkzeug weitreichende, praxisnahe Hilfestellungen.
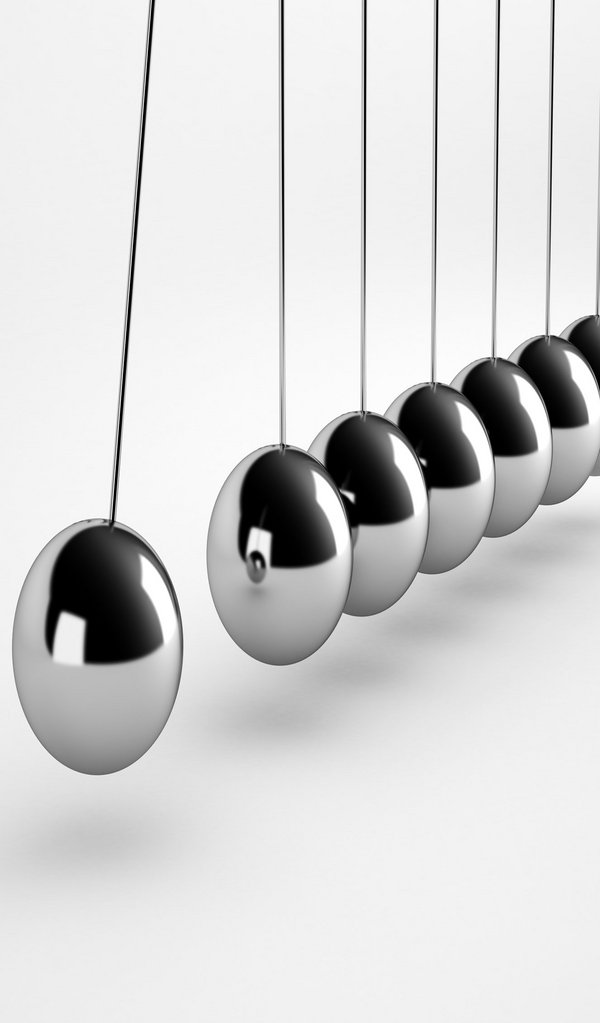

Qualifizierung
Wirkungsorientierung ist ein effektiver Ansatz in der Präventionsarbeit. Sie funktioniert aber nur dann, wenn Mitarbeitende in der Prävention das dafür notwendige Wissen haben und über entsprechende Fähigkeiten verfügen. Um eine solche Qualifizierung zu erreichen, hat die Polizei Standards in der Aus- und Fortbildung festgelegt. Die Lehrinhalte sollen demnach praxisbezogen, zielgruppenorientiert sowie auf die spezifischen Aufgaben der Prävention zugeschnitten sein. Standard ist weiterhin ein modularer Aufbau der Aus- und Fortbildung, bestehend aus dem Basismodul, einem Aufbaumodul, Spezialmodul und einem Auffrischungsmodul.
Für angehende Führungskräfte wird an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) ein Wahlpflichtmodul zur wirkungsorientierten Kriminalprävention angeboten. Dessen Inhalte sind am Qualifizierungsprogramm Beccaria (www.beccaria-qualifizierungsprogramm.de) angelehnt.
Der berufsbegleitende Masterstudiengang „Kriminologie und Kriminalprävention“ an der Berlin Professional School (https://www.berlin-professional-school.de/master/berufsbegleitend-studieren/master-kriminologie-und-kriminalpraevention/) setzt an dieser Stelle an und ergänzt das Beccaria-Qualifizierungsprogramm.
Natürlich kostet Qualität, aber fehlende Qualität kostet mehr.
Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger